des Busfahrers kann ich mich nicht erinnern. Nur dass er mit der Abfahrt geduldig wartete, bis ich für das Lebkuchenhaus vom Weihnachtsbasar der Schule einen sicheren Ablageplatz gefunden hatte. Es war dunkel in dem Bus. Ein irgendwie ältliches Licht schuf eine Schummrigkeit, wie ich sie aus meiner Kindheit erinnere. Die Welt war damals ein weniger ausgeleuchteter Ort.
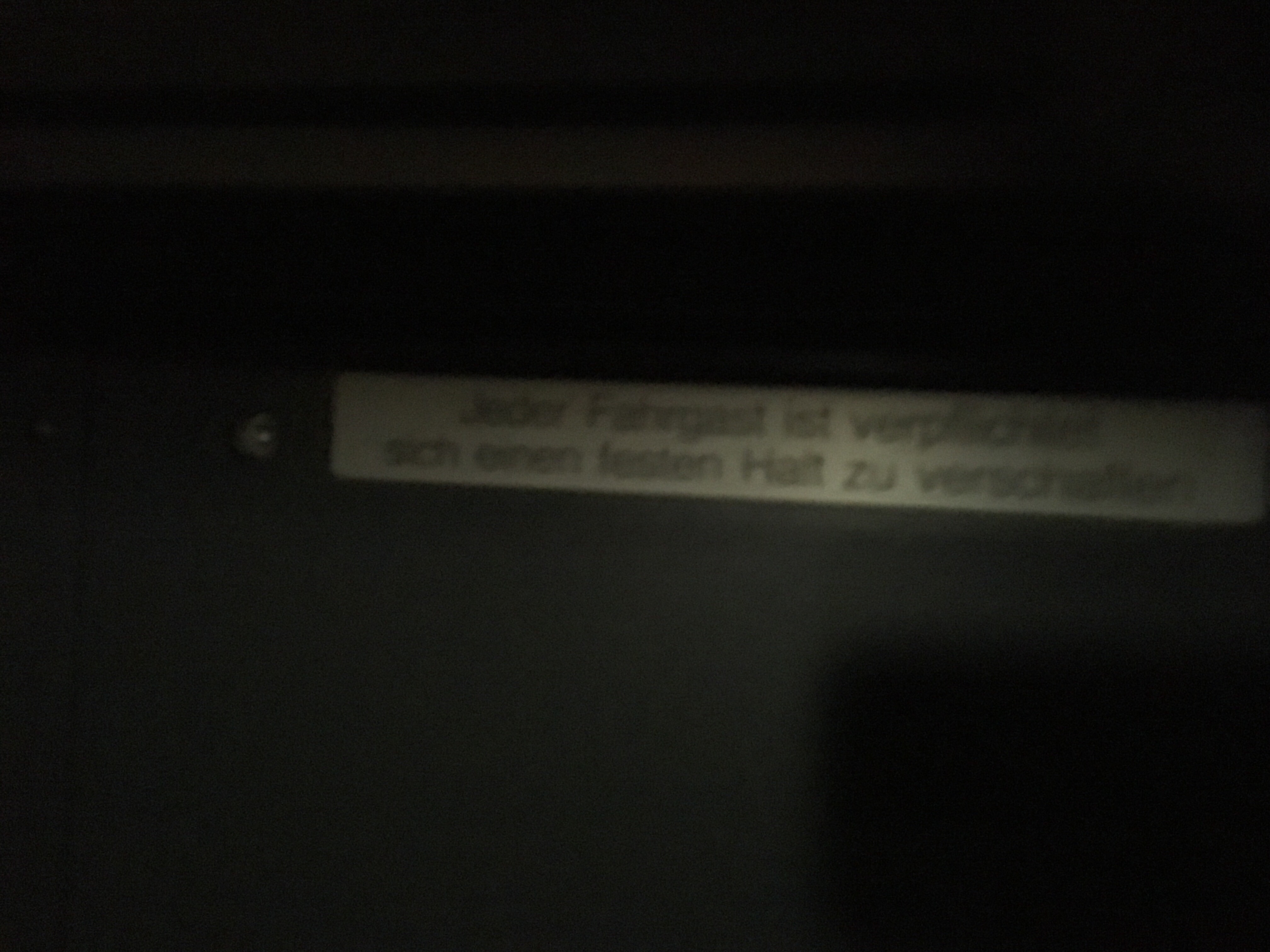
Die Kinder hatten sich weit nach hinten verdrückt. A. auf die letzte Bank; N. saß mit einem Mitschüler eine Sitzreihe davor. Als ich mich zu A. setzen wollte, fiel mein Blick auf das Schild. Es war über der Heckscheibe des Busses befestigt und im Dunkeln kaum wahrzunehmen. „Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich einen festen Halt zu verschaffen.“ Die ängstliche Regulationswut, die in dieser Anordnung steckt, fand ich putzig. Gleichzeitig ist etwas Anrührendes darin. Weil von irgendwo aus dem Dunkel hinter diesem Satz ein Seufzen zu hören ist. Über die vergebliche Mühe, in diesem Leben immer und sicher auf den Beinen bleiben zu wollen.
Ich versuchte mir den Menschen vorzustellen, der sich diesen Satz ausgedacht hatte. Ich sehe dabei einen Mann vor mir. Er hat schütteres, streng zurück gekämmtes Haar. Sein weißes Hemd ist mit einem feinen, rot-blauen Gittermuster versehen. Über dem Hemd trägt er einen weinroten Westover. Die Manschetten seines Hemdes hat er zweimal zurückgeschlagen. Es ist Abend und er sitzt länger in seinem Büro, als er es üblicherweise tut. Er kommt mit diesem Satz nicht zurecht, den er zu fomulieren hat. Morgen sollen die Hinweisschilder in Auftrag gehen und dieser Satz will ihm nicht gelingen. Er starrt in die Dunkelheit hinter dem Lichtkegel seiner Schreibtischlampe. Die Kollegen sind alle schon gegangen. Es ist still. Und nichts ist so still wie das Grün der Schreibunterlage, auf die er sich seit Jahren stützt und die ihm jetzt keinen Halt mehr verschafft.
